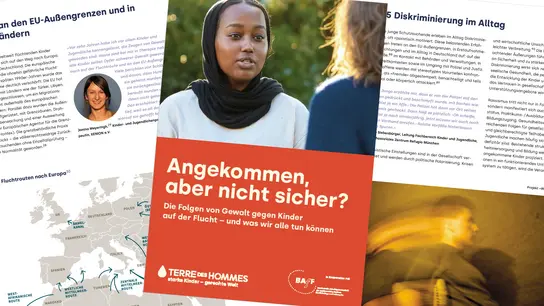Geflüchtete Kinder und Jugendliche erleben zunehmend schwere Gewalt vor, während und auch nach der Flucht – von Pushbacks und sexualisierter Gewalt bis zu eingeschränktem Zugang zu Bildung, Gesundheit und zu sicheren Unterkünften. Die Reformen der Europäischen Asylpolitik (GEAS) verschärfen die Situation des (un)sicheren Ankommens.
Der Bericht von Terre des Hommes und in Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF e.V) dokumentiert die Folgen der Gewalt gegen Kinder auf der Flucht für ihre psychische Gesundheit, ihre Rechte und Teilhabe in Deutschland. Der Bericht gibt praxisnahe Handlungsempfehlungen, insbesondere für pädagogische und soziale Fachkräfte, und liefert wertvolles Hintergrundwissen, um gemeinsam zu mehr Sicherheit, Schutz und Teilhabe für geflüchtete Kinder beitragen zu können.
Bericht »Angekommen, aber nicht sicher?«
Der Bericht dokumentiert die Folgen der Gewalt gegen Kinder auf der Flucht für ihre psychische Gesundheit, ihre Rechte und Teilhabe in Deutschland.
Zum DownloadWas kann ich ehrenamtlich, als Lehrer*in oder Sozialarbeiter*in tun?
Ehrenamtlich Engagierte, Lehrer*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und Fachkräfte in Jugendhilfe, medizinischer und psychosozialer Versorgung sowie in den Unterkünften für Geflüchtete sind häufig wichtige Ansprechpersonen für die jungen Menschen. Sie können maßgeblich zu deren Sicherheit, Schutz und Teilhabe beitragen.
Kinder sind eigenständige Rechtsträger*innen mit individuellen Bedürfnissen, Erfahrungen und Perspektiven. Es ist daher wichtig, sich mit den Kinderrechten und ihren Implikationen für geflüchtete Minderjährige vertraut zu machen, dies im Team zu besprechen und die Rechte aktiv in der Praxis zu berücksichtigen.
Kinder brauchen sichere Räume und konsequent Schutz vor Gewalt und Vernachlässigung. Lehr- und Fachkräfte müssen physische, psychische und sexualisierte Gewalt erkennen, ernst nehmen und entsprechend handeln. Gewalt- und Kinderschutzkonzepte in Einrichtungen dürfen nicht nur formal bestehen, sondern müssen gelebt und immer wieder überprüft werden. Beziehungen, die auf Vertrauen und Stabilität beruhen, sind für Kinder mit Fluchterfahrungen ein elementarer Schutzfaktor. Diese aufzubauen und zu halten, erfordert Zeit, Aufmerksamkeit und eine traumasensible Haltung.
Lehrer*innen und Fachkräfte sind wichtig beim Erkennen psychischer Belastungen und um belastete junge Menschen in Unterstützungsstrukturen weiterzuvermitteln. Es sollten Informationen über Angebote und Hilfen vorliegen, auch bei unsicherem Aufenthaltsstatus. Frühe Anzeichen für Traumafolgestörungen sind ernst zu nehmen. Psychische Reaktionen können als Ausdruck von Bewältigungsstrategien in hochbelastenden Lebenslagen verstanden werden. Fortbildungen in traumasensibler Arbeit können helfen, angemessen zu reagieren.
Ein wichtiger Beitrag besteht darin, wirkungsvolle Beteiligung zu ermöglichen. Geflüchtete Kinder und Jugendliche sollen in Entscheidungen, die sie betreffen, einbezogen werden. Lehr- und Fachkräfte können altersgerechte Beteiligungsformate schaffen und fördern, in denen junge Menschen ihre Meinung angstfrei äußern und Selbstwirksamkeit erleben können.
Ehrenamtlich Engagierte, Lehrer*innen und Fachkräfte sind gefordert, sich mit Diskriminierung und Rassismus auseinanderzusetzen – sowohl im Umgang mit geflüchteten Familien als auch im institutionellen Kontext. Das bedeutet, die eigene Haltung und berufliche Strukturen zu reflektieren, rassistische oder diskriminierende Vorfälle zu benennen und dagegen vorzugehen. So können eine Verbündetenrolle eingenommen, Empowerment unterstützt und die Kinder und Jugendlichen gestärkt werden.
Es lässt sich viel bewirken, wenn die verschiedenen Akteur*innen sich in lokalen Netzwerken mit anderen austauschen: z. B. Schule, Gesundheitswesen, Jugendhilfe, Ehrenamt, migrantische Selbstorganisation. Gemeinsam lassen sich Lücken identifizieren, Übergänge besser gestalten und Ressourcen bündeln, um gestärkt zu intervenieren.
Lehrer*innen und Fachkräfte haben eine wichtige Rolle: Sie erleben, wo Systeme versagen, Ressourcen fehlen oder Menschen- und Kinderrechte verletzt werden. Sie können diese Erfahrungen in fachliche, öffentliche und politische Debatten einbringen. Ihre Expertise hilft, Verbesserungen anzustoßen und menschenrechtsbasierte Standards einzufordern. Auch wenn individuelle Handlungsspielräume begrenzt sind, lässt sich durch Haltung, Wissen und Engagement dazu beitragen, geflüchtete Kinder gemeinsam zu stärken.
Weiterführende Hinweise und Tipps für die Praxis
Broschüre: Traumasensible und diskriminierungskritische Arbeit mit flüchtenden Menschen. Ein Praxisleitfaden (BAfF, 2025)
Broschüre: Mächtige Narrative - was wir uns (nicht) erzählen. Über den Zusammenhang von Gewalt, Stress und Trauma im Kontext Flucht (BAfF, 2025)
Toolbox: Trauma - Was tun im Notfall? Toolbox zum Umgang mit herausfordernden Situationen Die Toolbox bietet erste Orientierung, Übungen und Hinweise zum Themenbereich Trauma. Sie richtet sich an Ersthelfer:innen und Fachpersonen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in herausfordernden Situationen. (REFUGIO Thüringen, 2024)
Toolbox: Methodenschatzkiste für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit ressourcenorientierte Übungen aus der psychosozialen Arbeit (Save the Children, 2023)
Comic-Handbuch (mit Übungen) für Fachkräfte und Aktivist:innen zum Umgang mit Stress, herausfordernden Situationen und Konflikten: „Ich kann das!” (Libereco, 2024)
Bericht: Kein Ort für Kinder. Perspektiven junger Schutzsuchender auf Unterbringung (Terre des Hommes, 2024)
Bericht: Das ist nicht das Leben. Perspektiven von Kindern und Jugendlichen in Unterkünften für geflüchtete Menschen (UNICEF & DIMR, 2023)
Bericht: Living in a box. Psychosoziale Folgen des Lebens in Sammelunterkünften für geflüchtete Kinder (BAfF, 2020)
E-Learning-Programm für lehr- und sozialpädagogische Fachkräfte, die mit geflüchteten, traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeiten: trauma-sensibel.de
Infobroschüre für Jugendliche Schule und Recht auf Bildung in Deutsch und Ukrainisch (BuMF, 2022)
Handbuch für pädagogische Fachkräfte: Healing Classrooms. Sichere Orte für gemeinsames Lernen (IRC, 2024)
Broschüre: Das Asylverfahren. Deine Rechte, deine Perspektiven erklärt für unbegleitete Minderjährige in 7 Sprachen: Deutsch, Arabisch, Französisch, Englisch, Russisch, Spanisch, Persisch/Dari, Türkisch (BuMF & FR Niedersachsen, 2023)
Infosammlung: Asylverfahren bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten (BuMF, 2025)
Infosammlung: Abschiebungen aus Schulen, Kitas und Betrieben (Informationsportal basiswissen.asyl.net, 2024)
Handreichung: Hinweise zum pädagogischen Umgang mit der Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten. Familiennachzug ausgesetzt - Hoffnungen zerstört – Wie können Fachkräfte unbegleitete Minderjährige jetzt gut begleiten? (BuMF, 2025)
Broschüre: Solidarität macht stark. Ein Wegweiser für Jugendliche im Umgang mit Diskriminierung (Für Jugendliche, Deutsch) (Gladt, 2019)
Verzeichnis: Rassismuskritisch und empowernd arbeiten mit jungen geflüchteten Menschen (BuMF, 2022)
Ratgeber: Was tun nach einem rassistischen Angriff? Empfehlungen für Betroffene in 16 Sprachen (VBRG, 2024)
Handreichung: Rechte Gewalt – Eine Herausforderung für Schulen. Handreichung für einen professionellen Umgang mit Betroffenen rechter Gewalt im Kontext Schule (Opferperspektive – Solidarisch gegen Rassismus, Diskriminierung und rechte Gewalt e.V., 2020)
Handreichung: Die „Bildungslücke Rassismus“ schließen! Handlungsmöglichkeiten im Kontext Schule (LIFE Bildung Umwelt Chancengleichheit e.V., 2025)
Forderungen
Nach der Ankunft in Deutschland sind viele schutzsuchende Kinder und Jugendliche weiterhin Diskriminierung, Gewalt, asylrechtlichen Unsicherheiten und eingeschränkten Zugängen zum Bildungs- und Gesundheitssystem ausgesetzt. Für die jungen Menschen bedeutet das: eine Fortsetzung von Traumatisierung statt Ankommen in Sicherheit. Um die Folgen dieser Gewalt zu bewältigen und weitere Traumata zu verhindern, braucht es mehr als individuelle Unterstützung. Es braucht strukturelle Veränderungen, kinder- und jugendgerechte Bedingungen und sichere Orte, die ein Leben nach Gewalt, Flucht und Vertreibung ermöglichen.
Auf Basis der Recherche formulieren wir folgende Forderungen:
1. Legale Einreisemöglichkeiten deutlich ausweiten. Aktuelle Abschottungspolitiken ignorieren, dass es kaum legale Fluchtwege gibt, um im Notfall fliehen zu können. Dies zwingt Menschen dazu, gefährliche, „irreguläre“ Routen zu wählen. Humanitäre Aufnahmeprogramme, Resettlement und erleichterte Verfahren zur Familienzusammenführung, insbesondere für unbegleitete Minderjährige und Geschwister, müssen dringend ausgebaut werden, um Kinder und Jugendliche zu schützen.
2. Verlässliche Bleibeperspektiven für alle schutzsuchenden Kinder und Jugendliche bieten – unabhängig von Herkunftsland oder Aufenthaltsstatus. Ungewissheit, Angst vor Abschiebung oder Asylverfahren retraumatisieren und verhindern Integration. Sicherheit und Schutz sind Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung. Daher müssen Asylverfahren konsequent am Schutz der geflüchteten Kinder und Jugendlichen ausgerichtet sein – was in der Praxis leider oft nicht der Fall ist.
3. Unterbringung muss gewaltfrei, kindgerecht und dezentral erfolgen. Viele geflüchtete Kinder und Jugendliche berichten von Gewalt, Vernachlässigung und fehlendem Schutz in Unterkünften. Präventiv müssen alle Unterkünfte verpflichtend über funktionierende und regelmäßig geprüfte Konzepte zum Gewalt- und Kinderschutz verfügen. Kinder dürfen nicht über Monate oder Jahre in Sammelunterkünften leben. Sie brauchen Privatsphäre, Stabilität, Zugang zu Unterstützung, pädagogische und psychosoziale Angebote.
4. Schutz vor Diskriminierung und traumasensible Fachkräfte. Ausgrenzung, institutioneller Rassismus und fehlender Zugang zu Gesundheit, Bildung und weiteren Kinderrechten sind Formen struktureller Gewalt, vor der Kinder und Jugendliche wirksam geschützt werden müssen. Dafür ist auch eine größere Anzahl interdisziplinär ausgebildeter, diskriminierungs- und traumasensibler Fachkräfte in der Jugendhilfe, in Schulen, im Gesundheitswesen und in der Justiz erforderlich.
5. Psychosoziale Versorgung bedarfsgerecht und flächendeckend sicherstellen. Zugang zu psychosozialer und therapeutischer Unterstützung darf nicht vom Aufenthaltsstatus abhängen. Es braucht niedrigschwellige und kostenfreie Angebote für Kinder und Familien sowie nachhaltige Finanzierung spezialisierter Einrichtungen (z. B. PSZ) durch Bund und Länder. Sprachmittlung in Therapie und Beratung muss gesetzlich verankert und öffentlich finanziert werden. Systematische Verfahren zur Bedarfsfeststellung (in Schulen, Kitas, Unterkünften) mit klaren Weitervermittlungswegen sind nötig; Abschiebungen trotz attestierter psychischer Erkrankungen müssen ausgeschlossen werden.
6. Zugang zu Bildung und Betreuung garantieren. Kitas, Schulen, Ausbildungsstätten oder Hochschulen müssen unabhängig vom Aufenthaltsstatus offenstehen. Bürokratische Hürden und fehlende Plätze dürfen nicht dazu führen, dass Kinder monatelang nicht zur Schule gehen. Schulen brauchen Ressourcen, Fortbildungen und Konzepte für traumasensiblen Unterricht sowie flexible Lernformate, Schulsozialarbeit und Unterstützungsangebote zur Verhinderung von Schulabbrüchen.
7. Beteiligung und Möglichkeiten zur Selbstwirksamkeit stärken. Kinder und Jugendliche, die Gewalt und Flucht erlebt haben, brauchen Räume, in denen sie sich ausdrücken, ihre Stimme einbringen und Selbstwirksamkeit erleben können. Das Recht auf Mitbestimmung muss konsequent umgesetzt werden. Es braucht gezielte Förderung von Empowerment-Angeboten (z. B. Peer-Projekte, kreative Gruppenformate oder Freizeitangebote), um Selbstvertrauen und soziale Teilhabe zu stärken.
Ihre Ansprechpartnerin

Anna Weber
Referentin Deutschland- und Europaprogramm

EU-Förderung
Recherche und Bericht wurden kofinanziert aus dem Asyl-, Migrations-, und Integrationsfonds der Europäischen Union.