Interview mit vier geflüchteten Afghan*innen
Viele der Menschen aus Afghanistan, die als Jugendliche nach Deutschland gekommen sind, sind längst Teil der Gesellschaft: Sie leben hier, lernen hier und engagieren sich gesellschaftspolitisch. Im Gespräch berichten vier von ihnen – Mahdie, Mostafa, Robina und Parwana –, wie das Ankommen in Deutschland für sie war und wie sie die aktuellen Debatten über Afghanistan in Deutschland wahrnehmen.
Ihr vier seid alle als Jugendliche aus Afghanistan oder aus Iran geflohen. Wie habt ihr euch damit gefühlt, euer bisheriges Leben hinter euch lassen zu müssen?
Robina: Ich bin allein nach Deutschland gekommen, ohne Familie, ohne meine Eltern. Allein hier zu sein, war sehr hart. Du bist irgendwohin geflohen und musst plötzlich alles allein machen und kannst die Sprache nicht. Am schwersten war es, dass nach der Schule niemand zu Hause auf mich gewartet hat. Ich war ganz allein. Ich musste mich um alles kümmern.
Parwana: Meine Familie hat mir damals gesagt, dass wir nur für drei Monate in den Ferien nach Iran reisen würden. Danach würden wir wieder nach Afghanistan kommen. Sie wussten, dass ich es nie akzeptiert hätte, einfach meine Schule zu verlassen und für immer weg zu gehen. Aber meine Eltern mussten diese Entscheidung für uns alle treffen, weil meine Brüder bedroht wurden.
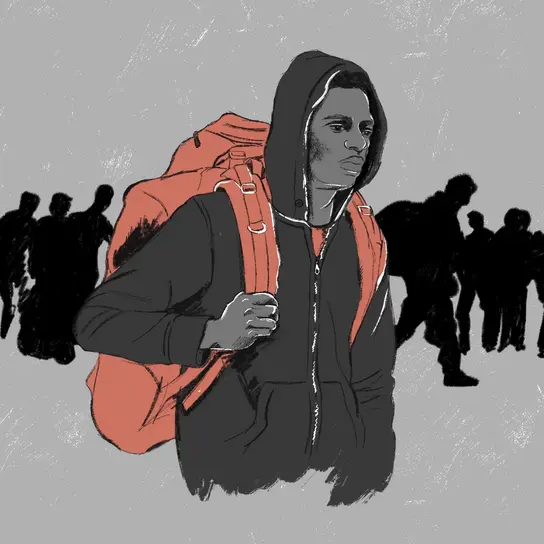
Mostafa: Als ich 2015 nach Deutschland kam, war ich 15 Jahre alt und hatte die Entscheidung ganz allein getroffen, ohne die Erlaubnis meiner Eltern. Sie wussten von nichts. In Iran hätte ich keine Zukunft gehabt: Als Afghane bist du dort ein Mensch zweiter Klasse. Außerdem hatte ich immer Angst vor einer Abschiebung nach Afghanistan. Seit ich klein war, hatte ich immer ein Bild von den Taliban im Kopf. Ich hatte viele Videos gesehen, zum Beispiel wie sie Menschen umbringen.
Mahdie: Ich bin in Iran geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind vor 30 Jahren wegen des Kriegs in Afghanistan dorthin gekommen. Ende 2019 bin ich dann mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder aus Iran geflohen, denn die Situation für mich und meine Familie war nicht sicher. Als wir endlich in Griechenland ankamen, wurden wir in das Camp Moria auf Lesbos gebracht. Die zwei Jahre dort waren die schlimmste Zeit meines Lebens: Wir haben in einem Zelt gewohnt, egal ob es geregnet hat oder sehr heiß war. Es gab keinen Strom, manchmal hatten wir tagelang kein Wasser. Und wenn wir welches hatten, war es oft nicht trinkbar. Es war dreckig, laut und gefährlich, vor allem für Frauen und Kinder. Wir lebten in ständiger Angst. Ich hatte in dieser Zeit das Gefühl, vergessen worden zu sein. Aber die Hoffnung auf ein normales Leben hat mich irgendwie am Leben gehalten.
Wie war das Ankommen in Deutschland für euch?
Robina: Ich wurde nach meiner Ankunft in Berlin in die Unterkunft in Tegel geschickt. Ich war nur zwei Tage oder drei Tage dort, ich konnte kaum schlafen. Ich war das einzige Mädchen, ich hatte solche Angst. Ich hatte in der ganzen Zeit unendliche Schmerzen, die psychische Gründe hatten, weil ich mir so viele Sorgen gemacht habe: In Afghanistan war ich Kind – und auf einmal kam ich in dieses Land mit einer anderen Sprache, voller Regeln und Pflichten. Besonders schlimm an der Bürokratie war für mich, wie die Senatsverwaltung und die Ausländerbehörde gegen mich vorgingen – dabei hatte ich doch nichts getan und einfach nur Schutz gesucht. Nachdem ich den Schutzstatus bekommen habe, fragte ich mich: Wer wird für diese drei Jahre Schmerzen bezahlen? Wer wird sich dafür entschuldigen? Können sie mir meine Jugend, die sie mir genommen haben, jemals zurückgeben?
Mahdie: Ja, die Bürokratie war für mich auch eine große Herausforderung. Zwei Jahre nachdem ich angekommen war, bin ich 18 geworden und sollte ein Interview mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge machen. Mir wurden viele Fragen über Afghanistan gestellt. Aber ich war ja selbst nie in Afghanistan … Ich habe gelernt, Schritt für Schritt meinen Weg zu finden. Am Anfang war es sehr schwer, mit der Bürokratie klarzukommen. Ich war ja ziemlich jung. Ich hatte damals das Leben noch nicht verstanden, einfach nur nach Sicherheit gesucht.
Mostafa: Für mich war es in der Zeit des Ankommens vor allem schwierig, für längere Zeit in einem Heim zu wohnen, mit vier Personen in einem Zimmer. Ich konnte oft nicht schlafen und habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es sich wirklich gelohnt hat, hierherzukommen. Ich hatte alles verloren. Mein Land, mein Zuhause, meine Familie. Anfangs hatte ich noch keine Freunde und konnte nicht zur Schule gehen. Es war richtig langweilig, wir waren alle depressiv, deswegen gab es auch oft Streit zwischen uns.
Parwana: Eine wichtige Sache für mich ist, dass ich gemeinsam mit meiner Familie die Grenzen überquert habe. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie gefährlich es für Kinder und Jugendliche sein muss, diese Reise ganz allein machen zu müssen.
Hat sich im letzten Jahr – besonders nach den Terroranschlägen durch afghanische Staatsangehörige und mit den verschärften Abschiebedebatten – verändert, wie Menschen in Deutschland darauf reagieren, dass ihr aus Afghanistan kommt?
Mahdie: Ich finde, dass Afghanistan in Deutschland oft nur dann ein Thema ist, wenn etwas Schlimmes passiert. Viele Menschen in Deutschland wissen gar nicht, wie die Menschen in Afghanistan leben oder wie es uns geht. Es fehlt oft an Empathie. Ich fühle mich selten wirklich gehört, wenn über Afghanen gesprochen wird. Ich wünsche mir mehr echte Gespräche, bei denen wir unsere Geschichte erzählen dürfen. Ich wünsche mir, dass unsere Erfahrungen ernster genommen werden und wir nicht nur als schlechte Menschen gesehen werden.
Parwana: Wenn ich gefragt werde, woher ich komme, und Afghanistan sage, kommt immer nur: „Oh, Taliban!“ Oder: „Die Mädchen dürfen nicht zur Schule gehen, oder?“ Einmal habe ich bei einer Veranstaltung über die Situation von Geflüchteten an den EU-Grenzen gesprochen. Manche Fragen aus dem Publikum sind gemein, zum Beispiel zur Kleidung oder zum Kopftuchtragen. Sie sagen: „Du bist nicht mehr in Afghanistan. Hier gibt es keine Taliban. Warum hast du dein Kopftuch weiter an?“ Das tut weh.
Mostafa: Ich bin wirklich enttäuscht von den deutschen Medien. Über die schlimme Lage in Afghanistan wird nicht gesprochen. Es wird nur berichtet, wenn jemand einen Anschlag verübt, und dann werden auf einmal alle Afghanen zusammen verurteilt. Was haben die anderen Afghanen, die hier in die Schule gehen oder ihre Ausbildung machen, denn damit zu tun? Die Medien zeigen ein schlechtes Bild von den afghanischen Flüchtlingen, die hier in Deutschland sind. Wir sind nicht die Taliban. Im Gegenteil: Viele von uns sind vor den Taliban geflohen.
Parwana: Wir müssen nicht nur insgesamt mehr über Afghanistan reden, wir müssen besonders auch über die Minderheiten sprechen und darüber, was mit ihnen passiert. Zum Beispiel müssen wir mehr über den Völkermord an den Hazara sprechen. Es gibt auch eine große LGBTQ+ Community in Afghanistan, die verfolgt wird. Wenn wir das auch erzählen, ergibt sich ein anderes Bild von Afghanistan, was viele vielleicht noch gar nicht gesehen haben.
Was denkt ihr über das, was die deutsche Politik in Bezug auf Afghanistan in den letzten Jahren beschlossen hat?
Robina: Nach der erneuten Machtübernahme der Taliban haben die SPD, Grünen und FDP beschlossen, dass sie mit dem Bundesaufnahmeprogramm monatlich tausend Menschen aus Afghanistan nach Deutschland bringen wollten. Aber insgesamt wurden nur ganz wenige Menschen in Deutschland aufgenommen. Währenddessen habe ich verfolgt, wie Menschen in Afghanistan sterben. Dass sich Frauen verstecken. Dass inhaftierte Menschen von den Taliban in den Zellen vergewaltigt, gefoltert und dann umgebracht wurden. Aber Deutschland hat immer die Bürokratie vorgeschoben, und gesagt: „Wir brauchen dieses Papier noch, und wir brauchen dies, wir brauchen das.“ Und jetzt soll das Programm sogar ganz gestoppt werden.
Mostafa: Deutschland war ja jahrelang in Afghanistan im Einsatz, gemeinsam mit den USA. Sie haben eine große Verantwortung. Sie haben in Afghanistan für große Hoffnung gesorgt – und dann einfach das Land verlassen. Und jetzt? Jetzt wurde Afghanistan auf einmal vergessen. Über das Land wird nur noch gesprochen, wenn es darum geht, wer abgeschoben werden kann. Niemand spricht über die katastrophale Menschenrechtslage, über die Unterdrückung der Frauen in Afghanistan und über die Armut, den Hunger und die anderen wichtigen Themen.
Robina: Deutschland sagt ja: „Was die Taliban gerade in Afghanistan machen, ist nicht in Ordnung.“ Und trotzdem trifft die deutsche Regierung Vereinbarungen mit anderen Ländern, um Afghanen abschieben zu können. Oder sie wollen sogar direkt mit den Taliban zusammenarbeiten. Es gibt doch in Deutschland ein Strafgesetzbuch: Wenn jemand eine Straftat begeht, muss die Person verurteilt werden – das gilt natürlich auch für Geflüchtete. Aber Menschen nach Afghanistan abzuschieben, widerspricht den Menschenrechten. Mir scheint, in Deutschland ist es gerade egal, ob Menschen in Afghanistan der Tod droht.
Ihr lest all diese heftigen Nachrichten aus Afghanistan, ihr hört von euren Freunden dort. Wie haltet ihr das aus? Und was motiviert euch trotzdem, weiterzumachen?
Mostafa: Ich werde niemals vergessen, woher ich komme und warum ich hier bin. Das motiviert mich immer. Und deswegen strebe ich immer weiter. Ich will hier meine Ziele erreichen. Das merke ich zum Beispiel in meiner Schule: Dort bin ich sehr ehrgeizig.
Parwana: Ich denke, ich kann eine Brücke sein. Zwischen der europäischen Gesellschaft und den Menschen in Afghanistan. Die Leute hier brauchen diese Infos – und die Menschen in Afghanistan müssen gehört werden. Das motiviert mich, weiterzumachen.
Robina: Ich fühle mich nicht deutsch. Aber auch nicht ganz als Afghanin. Ich lebe jetzt zwischen zwei Welten. Es tut oft weh, die Nachrichten aus Afghanistan zu hören – und mich dann zu fragen: Was unterscheidet mich von einer afghanischen Frau? Was von einer deutschen Frau? Auch die Frauen in Afghanistan haben Rechte. Warum wurden sie ihnen genommen? Ich sage mir: Die Taliban wissen genau, wie stark afghanische Frauen sind. Sie kämpfen für ihre Rechte – und ich glaube, dass alle Frauen auf der Welt diese Stärke in sich tragen. Deshalb will ich den afghanischen Mädchen und Frauen das Gefühl geben: Ihr seid nicht allein. Wir kämpfen zusammen.
Gesprächspartner*innen
Mahdie ist 20 Jahre alt, kommt aus einer afghanischen Familie und ist in Iran geboren. Seit drei Jahren lebt sie in Deutschland, wo sie derzeit die gymnasiale Oberstufe besucht. Neben der Schule beschäftigt sich Mahdie intensiv mit Sprachen und Bildung. Besonders engagiert sie sich dafür, anderen jungen Menschen Mut zu machen, die wie sie neu nach Deutschland gekommen sind.
Robina ist 24 Jahre alt. Mit 16 Jahren floh sie ohne ihre Familie aus Afghanistan nach Deutschland. Inzwischen studiert sie Wirtschaftsingenieurwesen. Neben ihrem Studium engagiert sich Robina als Young Advocate bei Terre des Hommes, um auf die schwierige Situation der Menschen in Afghanistan aufmerksam zu machen. Außerdem ist sie bei der Organisation „Jugendliche ohne Grenzen“ aktiv und arbeitet als ehrenamtliche Dolmetscherin.
Parwana ist 20 Jahre alt und Autorin und Aktivistin aus Afghanistan. In griechischen Lagern schrieb sie Bücher und startete Bildungsproteste ("Baut Schulen, keine Mauern"). Mit dem "Young Refugees Movement" kämpft sie für Geflüchtetenrechte. Heute lebt Parwana in Deutschland, besucht die Oberstufe und schreibt weiter. Sie sagt: „Meine Worte sind mein Widerstand.“
Mostafa ist 25 Jahre alt. Mit 15 Jahren kam er nach Deutschland. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Abiturs macht er derzeit eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker mit dem Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik.
