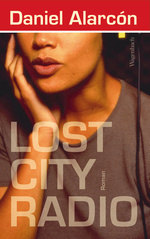Daniel Alarcón: Lost City Radio
Wagenbach-Verlag, Berlin 2010
320 Seiten, 22,90 Euro
Wer Mitte der 80er Jahre nach Ayacucho ins Hochland von Peru flog, war dem Krieg nah. Hubschrauber kreisten fast permanent über der Stadt, viele Straßen waren gesperrt,. Die Menschen gingen rasch und sahen niemanden an. In den wenigen geöffneten Lokalen war man immer umgeben von Militärs und Spitzeln. Für die Besuche bei den Partnerorganisationen von terre des hommes, meistens Menschenrechtsgruppen, mussten Vorkehrungen getroffen werden. Wir sahen in die überwiegend ganz jungen Gesichter der Soldaten. Wir sahen auf Fotos die jungen Gesichter der Kämpferinnen und Kämpfer des Leuchtenden Pfads. Wir spürten die Angst der Leute. Die Situation war undurchdringlich, noch undurchdringlicher als Jahre zuvor in Nicaragua, Guatemala oder El Salvador, unkalkulierbarer als in Argentinien und Chile, unzugänglich für uns Ausländer, die wir als Weiße wenig Ahnung vom Leben und den Träumen der indianischen Bevölkerung hatten. An die Beobachtung erinnere ich mich: Dass die Kämpfer, egal auf welcher Seite, immer indianisch und immer jung waren. Wie merkwürdig ich das fand.
Die Angst ist immer präsent
Diese Beobachtung stellt Daniel Alarcón seinem Roman voran, dass es das Volk ist, das hingerichtet wird und das Volk ist, aus dem sich die Erschießungskommandos zusammensetzen. Diese Beobachtung bringt ihn dazu, seine Geschichte nicht in einem konkreten Land zu verorten, zum Beispiel in seinem Heimatland Peru, sondern in einem fiktiven Land spielen zu lassen. Das macht die Atmosphäre dichter, auch bedrückender, denn Angst vor Folter, vor Tod, vor Verschwinden sind immer präsent. Und da kein konkretes Land beschrieben wird, sind auch Ohnmacht und Ausweglosigkeit in allem zu spüren. Wie in einem Thriller oder einer Horrorgeschichte verdichtet sich Seite um Seite das Unheimliche, das Böse, und überwuchert Tapferkeit, Mut und Aufrichtigkeit der Menschen, die noch unterscheiden können.
Die Geschichte von den letzten Tagen Normas als Sprecherin eines Radioprogramms, in dem die Namen von Menschen, die gesucht werden, verlesen werden, beginnt, als der Krieg gegen die illegitime Guerilla-Gruppe IL 10 Jahre vorbei ist. Umsiedlungen haben stattgefunden, Säuberungen der Plätze und Straßen in der großen Stadt, die Orte haben keine Namen mehr, sondern sind mit Nummern versehen. Bestimmte Fragen dürfen nicht gestellt werden, zum Beispiel wann der Krieg zu Ende war, ob er überhaupt zu Ende ist, mit welchen Methoden die IL bekämpft wurde, was mit den Kämpfern der IL geschehen ist, der Name »Mond«, Folterzentrum des Militärs, darf nicht ausgesprochen werden. Die Bevölkerung soll vergessen. Die Sendung von Norma ist beliebt. Anrufer können Namen von Personen nennen, die sie gerne wiederfinden wollen. Namen aus der IL sind tabu. Normas Aufgabe ist es, die Anrufer zu beruhigen und ihnen Hoffnung zu geben, dass ihre Angehörigen wieder auftauchen.
Norma hofft
Wenn es kritisch wird, wird Musik eingeblendet. Die Beliebtheit verdankt Norma ihrer Stimme, die Wärme und Mitgefühl ausstrahlt. Die Arbeit ist nicht leicht für sie, denn Normas Mann ist ebenfalls verschwunden. Sie muss vermuten, dass er tot ist, aber sie weiß es nicht, schon Jahre hat sie nichts mehr von ihm gehört. Sie weiß wenig über ihn, ihr Herz hofft. Eines Tages steht Victor vor ihr, ein Junge aus dem Dorf 1797, mit einem Empfehlungsschreiben und einer Liste der Verschwundenen. Sie solle ihm weiterhelfen und die Liste verlesen, er habe in dem Dorf keine Zukunft. Der Junge war mit seinem Lehrer losgeschickt worden. In Rückblenden wird die aufregende Reise vom Dschungeldorf in die Stadt beschrieben. In Rückblenden erfahren wir, wie Norma ihren Mann Rey kennengelernt hat, wie er gleich zu Beginn ihrer Bekanntschaft für einige Zeit auf dem »Mond«, dem Folterzentrum, gelandet ist, wie er in Kontakt mit den IL gekommen ist, welche Liebe er zu Pflanzen und Tieren hatte, wie er gelernt hat, sich sicher im Urwald zu bewegen, wie er schließlich im Dorf 1797 gelandet ist, als es noch einen Namen hatte. In der Stadt lebte er bei seiner Frau Norma, im Dorf 1797 bei Adele. Von dort verschwand er dann auch immer für längere Zeit im Urwald. Man erfährt, dass es nicht weit von 1797 ein Camp der IL gegeben habe. Victor ist sein und Adeles Sohn. Als Adele stirbt, wird Victor als Bote des Dorfes ausgewählt und in die Stadt geschickt. Das Militär weiß über Rey Bescheid, denn im Dorf gibt es einen sehr mitteilsamen Spitzel, an dem sich die IL später, als das Ende des Krieges schon verkündet wurde, rächt.
Sondersendung
Die Erschütterung Normas ist groß, als sie sieht, dass auf der Liste des Jungen der Name ihres Mannes steht. Was hatte Rey in 1797 zu suchen? Erst später wird ihr klar, dass Victor Reys Sohn ist. Sie weiß, dass sie die Liste des Dorfes insgesamt und Reys Namen schon gar nicht vorlesen darf. Sie liebt das Radio, empfindet es aber auch als Last, da weder die Anrufer noch sie frei reden dürfen, die Zensur ist vorhanden, Krieg darf nicht erwähnt werden. Sie trifft eine Entscheidung und macht sich nachts trotz Ausgangssperre mit Victor und seinem Lehrer auf den Weg zum Radio. Eine Sondersendung kündigt sie an und damit zugleich ihre Verhaftung. Die Hoffnung bleibt, dass dem Kind nichts geschieht. Das Kind liest die Namen seines Dorfes und alle Namen auf der Liste vor. Norma wartet auf Anrufe.
Das Buch fesselt den Leser von der ersten Seite an. Die Beziehung zwischen Norma und Rey ist verwoben mit dem Beginn und der Vertiefung des Krieges gegen die IL, mit der Ausdehnung der alltäglichen Repression. Man versteht, wie sich das Leben in den Urwalddörfern im Laufe des Krieges verändert. Der Krieg endet, aber das angeordnete Vergessen führt zu andauernder Bedrückung, von der sich Norma schließlich befreit. Am Ende des Buches erfährt der Leser auch, wie Rey umgekommen ist, man hat es geahnt.
Gerade in Peru hat das Vergessen gut geklappt. Der Krieg war immer weit weg, im Hochland und im Amazonastiefland und schließlich waren vor allem Indígenas betroffen. Das städtische Lima hat diese Zeit nie wirklich aufgearbeitet, das jedenfalls sagen Menschenrechtsorganisationen, die sich nach wie vor mit den Verschwundenen beschäftigen. Insofern ist es beeindruckend, dass nun ein Autor, der seit der Kindheit außerhalb des Landes lebt, die dunkle Geschichte seines Heimatlandes aufnimmt und einen Roman darüber schreibt.
Daniel Alarcón wurde 1977 in Lima/ Peru geboren, lebt aber in Kalifornien und schreibt in Englisch und Spanisch. Lost City Radio
ist 2007 in den USA erschienen. Es ist sein erster Roman, für den er viel Lob erhielt. Zuvor hatte er Kurzgeschichten und Anthologien veröffentlicht. Ein Band mit Erzählungen ist Ende August 2012 beim Wagenbach-Verlag in Berlin unter dem Titel »Stadt der Clowns« erschienen. Auch dieses Buch haben wir auf unseren Seiten rezensiert (Rezension lesen). In beiden Büchern sind Armut und die aus ihr hervorgehende Gewalt und ihre Verselbständigung das Hauptthema. Daniel Alarcón wurde vielfach mit den großen lateinamerikanischen Erzählern wie zum Beispiel Alejo Carpentier oder Miguel Angel Asturias verglichen.
Rezension: Monika Huber
Ein Gesamtübersicht aller in dieser Rubrik besprochenen Bücher und Leseempfehlungen finden Sie auf unserer Seite »terre des hommes-Medientipps«.